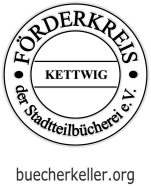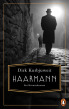Buchempfehlungen des „Literarischen Quartetts“ und seiner Freundinnen und Freunde
Wir ergänzen diese Rubrik in unregelmäßigen Abständen. Schauen Sie immer wieder mal vorbei! Und lassen Sie sich zum Lesen verführen. Stand: 05. Mai 2020
Dorothee Lehmann-Kopp stellt vor:
Gabriel Katz: Der Klavierspieler vom Gare du Nord
S. Fischer Verlag 2019 / ISBN: 9783596705078
„Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ ist ein Roman über Musik, über Freundschaften – und über das Aufeinanderprallen von gesellschaftlichen Welten. Der 20-jährige Mathieu Malinski lebt in den berüchtigten Pariser Außenbezirken, einem sozialen Brennpunkt. Seine Freunde sind Kleinkriminelle. Obwohl Mathieu als Kind durch einen Nachbarn seine Liebe zum Klavierspiel entdeckt hatte, könnte er nicht weiter von dem Universum klassischer Musik entfernt sein. An der Gare du Nord jedoch steht ein Klavier – und dort spielt er, nur für sich, ohne dass seine Kumpel etwas davon mitbekommen. Pierre Geithner, Professor am Pariser Konservatorium, hört ihn spielen und ist überzeugt, ein Ausnahmetalent vor sich zu haben. Sein Ziel ist, ihn zu fördern und für den Grand Prix d’excellence, den wichtigsten nationalen musikalischen Wettbewerb für junge Talente, anzumelden. Das geht natürlich nicht einfach glatt: Mathieu steht, kaum verwunderlich, sich selbst im Weg und fügt sich nicht ohne Weiteres ein, Pierre Geithner steckt selbst in einer Krise und leidet unter einer privaten Tragödie, es gibt Verwicklungen, Freundschaften, eine Liebesgeschichte - und bis zum Schluss bleibt es spannend, das Finale ungewiss.
Ungewöhnlich ist, dass zunächst der Film existierte (den ich übrigens noch nicht kenne), dann erst der Roman entstand. Gabriel Katz ist jedoch, wie ich finde, ein liebenswertes, mitreißendes literarisches Werk gelungen, mit eigener Musikalität, Dynamik und Rhythmik.
Birgit Dransfeld stellt vor:
Dirk Kurbjuweit: Haarmann. Ein Kriminalroman
Penguin 2020 / ISBN: 9783328600848
Wenn die Corona-Krise nicht dazwischengekommen wäre, dann hätte der Förderkreis aller Voraussicht nach Dirk Kurbjuweit im Juni nach Kettwig, seiner Heimatstadt in Jugendjahren, zu einer Lesung einladen können. So bleibt uns zurzeit nur der Blick in seinen sehr zu empfehlenden Kriminalroman.
Die Geschichte des Massenmörders Haarmann, der in den "goldenen" 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Hannover mindestens 20 Jungen und junge Männer tötete, ist in Deutschland bekannt wie andernorts Jack the Ripper. Sie wurde schon mehrfach erzählt, vertont und verfilmt. Und wer kennt nicht das Liedchen "Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Haarmann auch zu Dir ..."? Dirk Kurbjuweit hat einen Roman geschrieben, keine Dokumentation, keinen Tatsachenbericht. Er erzählt die Geschichte aus Sicht des Ermittlers Robert Lahnstein, eines von Bochum nach Hannover versetzten Kriminalkommissars. Die Spannung des Buches entsteht durch das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Täter und Ermittler. Lahnstein steht unter enormem Erfolgsdruck, gleichzeitig ringt er mit seinen eigenen verstörenden Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg und die revolutionäre Zeit danach. Die öffentliche Meinung, die Sorge um die politische Gefährdung der jungen Republik, das ablehnende, mauernde Verhalten mancher Kollegen im Polizeipräsidium, die Armut breiter Bevölkerungskreise, der Druck auf die "Hundertfünfundsiebziger" und schließlich auch die Frage, ob die Überschreitung rechtstaatlicher Grenzen im Verhör ein probates Mittel sein darf, um dem Morden durch ein Geständnis ein Ende zu bereiten - dies alles wird zu einem düsteren, spannenden Sittengemälde verwoben.
Abgesehen von der Erzählung des monströsen Falls finden sich immer wieder Bezüge zu realen Persönlichkeietn und Ereignissen in der Zeit der Weimarer Republik. Man kann das Buch auch ohne diese Verbindungen zu kennen mit Spannung und Gewinn lesen, aber für historisch Interessierte entstehen darüber hinaus noch weitere Bezugspunkte.
Benno Pöhler stellt vor:
Nino Haratischwile: Das achte Leben
Ullstein Taschenbuch / ISBN 9783548289274
Georgien? War da was? Wo liegt das noch? Seit Nino Haratischwile ihr preisgekröntes Buch Das achte Leben herausgebracht und die Bestsellerlisten erobert hat, befassen sich Leserinnen und Leser mit Georgien, diesem kleinen Land am Rande der Schwarzmeerküste.
Das Buch - ein gewichtiges Werk! Ich folgte der Empfehlung der Buchhändlerin und habe das 1257 Seiten umfassende und 985 Gramm schwere Werk mittels scharfem Messer in drei handliche Teile zerlegt – und physisch lesbar gemacht; zumal ich auch ein Bettleser bin. So konditioniert lässt sich der fulminante Stoff ausgezeichnet lesen.
Haratischwile spannt einen Jahrhundertbogen über eine georgische Familie, angefangen weit vor dem ersten Weltkrieg, bis ins neue Jahrtausend, ein Drama über insgesamt nicht weniger als sechs Generationen. Frauen und ihre Schicksale spielen in diesem Roman die Hauptrollen. Sie dominieren die Erzählung aber ohne ein Frauenroman zu sein – was immer das auch ist. Ein Teil der Familie macht Karriere im Kommunismus, während andere sich eher mystischen Welten hingeben und ihren Individualismus ausleben. Bemerkenswert welche Individualität im kommunistischen Georgien dieser Zeit dann doch wohl möglich war. Wüsste man es nicht, bei der Lektüre käme man nur schwerlich auf den Gedanken, dass der Roman eine Zeit umfasst, in der eines der unmenschlichsten Regimes aller Zeiten das Land beherrscht hatte. Oder bildete Georgien eine Ausnahme, war verschont worden? Schwerlich vorstellbar. Für meinen Geschmack wird der Schrecken dieser Zeit ein wenig zu sehr folkloristisch verpackt.
Die Autorin zeichnet ihre Protagonisten ausführlich, detailliert und glaubwürdig. Auf so manche (Neben-) Figur hätte verzichtet werden können, das hätte gut und gerne Dutzende Seiten gespart und der Erzählung nicht geschadet. Spätestens in der Mitte des Buches bekommt man das Gefühl, dass die Figuren aus-erzählt sind und man neigt dazu ganze Seiten zu überschlagen. Nicht schade drum, denn insgesamt halten der Stoff und die Erzählweise den Leser bei der Stange und es bleibt spannend bis zum offenen Ende. Wer solide Unterhaltung sucht, ist mit dem Roman bestens bedient. In meiner persönlichen Rang-, und Beurteilungsliste, bekommt das Buch beim Kriterium „würde ich es nochmal lesen?“ ein „eher unwahrscheinlich“. Ich habe mir angewöhnt, solche Bücher zu leihen.
Eva Beyer-Schneider stellt vor:
Matt Haig: Wie man die Zeit anhält
dtv / ISBN 978-3-423-21810-8
Das Buch ist nicht ganz neu, wie es sonst für das Literarische Quartett der Fall ist, aber das hat den Vorteil, dass es schon als Taschenbuch verfügbar ist. Empfohlen hat mir das Buch der Kabarettist Christian Bader, der ein oder andere wird sich an ihn erinnern als einen Teil des Bader-Ehnert-Kommandos, das in den 90iger Jahren die Bühne der Brücker Aula gerockt hat.
Ein paar Jahre zurück kann sich fast jeder von uns erinnern, aber damit ist es dann auch schon gut. Ganz anders geht es der Hauptfigur in dem Roman "Wie man die Zeit anhält". Tom Hazard kann sich weit länger in die Vergangenheit zurückdenken, anhand eigener Erinnerungen. Er altert sehr langsam, unmerklich für seine Umgebung, er wirkt wie vierzig, ist aber über 400 Jahre alt.
Tom nimmt uns mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, erzählt uns aus der Sicht eines Zeitzeugens über Shakespeare, Captain Cook, die wilden 20er Jahre, seine große Liebe Rose, die der Pest zum Opfer fiel ... und ... und … (Zitat: „Was wir alles an Neuerungen erlebt haben: die Brille, die Druckerpresse, Zeitungen, das Gewehr, der Kompass, das Teleskop, die Pendeluhr, das Klavier, Impressionismus, Photographie, Napoleon, Champagner, Semikolon, Plakatwerbung, der Hotdog …“). Er durfte das alles erleben, aber der Preis war hoch. Um nicht aufzufallen, musste er alle acht Jahre sein komplettes Leben aufgeben und an anderem Ort wieder neu beginnen, persönliche Kontakte aufgeben, besser noch vermeiden, die Einsamkeit akzeptieren.
Deshalb stellt sich die Frage, was nützt die Option 1000 Jahre alt werden zu können, wenn man diese Zeit mit niemandem teilen kann und was immer auch von Bedeutung ist, zurücklassen muss? Wie verändert die Masse an Erfahrungen den Blick auf die Gegenwart?
Neben all dem Lesevergnügen, den diese Art von „Geschichtsunterricht“ bringt, lässt mich das Buch auch nachdenklich zurück. Möchte ich wirklich gerne so alt werden wie ein Baum?
Brigitte Nagel-Clemens stellt vor:
Sigrid Nunez: Der Freund
Aufbau Verlag / ISBN 978-3-351-03486-3
Apollo, der Hund, hat Arthritis, er ist 80 kg schwer, eine Dogge. Er trauert mit der namenlosen Ich-Erzählerin um den guten Freund, um sein Herrchen.
Der Verstorbene, Literaturprofessor, hoch gebildet, attraktiv, dreimal verheiratet, viele Affären, hat Selbstmord begangen. Er hat der Erzählerin seine Dogge Apollo vererbt.
Sie hat den Verstorbenen verehrt: Eine besondere, geistige, erotische, intellektuelle Beziehung. Jetzt hat die Erzählerin einen Trauerbegleiter an ihrer Seite.
Beide müssen lernen mit dem Schmerz und dem Verlust zu leben. Leben, in ihrem kleinen Appartement, in dem man keine Hunde halten darf. Auch nicht als Freund. Mit einem Trick erreicht sie die "Aufenthaltsgenehmigung" für Apollo. Schwierig gestaltet sich die "Erziehung". Apollo soll auf keinen Fall in ihrem Bett schlafen. Die Rangordnung muss geregelt sein. Also vor dem Bett. Natürlich liegt Apollo im Bett. Sein warmer Rücken überträgt die Wärme an den Rücken der Erzählerin. Das komplizierte Verhältnis erhält Nähe. Sie fragt sich, wie sie mit ihrem Hund kommunizieren soll, wie sie ihm Gefühle, Erinnerungen, Erwartungen vermitteln kann?
Sie liest Apollo Rilke "Briefe an einen jungen Dichter" vor. Er kommt dabei an ihren Schreibtisch. Sie sind auf Augenhöhe.
So setzen sie ihre Beziehung zum toten Freund fort. Apollo wird zum neuen Lebensmittelpunkt. Schritt für Schritt finden sie gemeinsam in ihr Leben zurück.
Im Text spricht Sigrid Nunez viel über Literatur: Wie man schreiben sollte, um Menschen zu fesseln; vielleicht um sie weicher zu stimmen.
Es ist ein Roman der Trauer, über das Wesen der Freundschaft, also über das Leben. Ein unaufdringlich, sehr kluges Buch, so meine ich. Ein umfassendes Nachdenken über Verlust.
Ich schließe mich der Erzählerin an. Nicht verbissen nach Fragen zu suchen, die das Leben aufgibt, sondern vielmehr, ohne Angst diese Fragen zu stellen.
Zitat: "Als Samuel Beckett an einem schönen Frühlingsvormittag mit einem Freund spazieren ging, fragte ihn dieser: Freut man sich an so einem Tag nicht, dass man am Leben ist? So weit würde ich nicht gehen, antwortete Beckett."
Karin Spiegel stellt vor:
Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen
Fischer Verlag / ISBN 978-3-10-491201-1
Die 1976 in Bordeaux geborene Autorin Laetitia Colombani wurde mit ihrem ersten Roman „Der Zopf“ weltweit bekannt. In ihrem neuen Roman „Das Haus der Frauen“ erzählt sie von Solène, einer erfolgsorientierten Staranwältin aus Paris.
Als sich ein Mandant nach verlorenem Prozess vor ihren Augen in den Tod stürzt, bricht sie zusammen, ihr Leben erscheint ihr sinnlos, sie erinnert sich an frühe Lebensträume.
Sie beginnt eine ehrenamtliche Tätigkeit und wird Briefschreiberin im Haus der Frauen. Hier begegnet sie einer Welt, die ihr bis dahin völlig fremd war. Sie muss gegen das Misstrauen dieser Frauen ankämpfen, sie will aufgeben. Aber mit jedem Brief, den sie für die Bewohnerinnen schreibt, fühlt sie sich diesen Frauen mehr verbunden. Gleichzeitig wird ihr Interesse an der Lebensgeschichte der Blanche Peyron geweckt, die 1926 in Paris eines der ersten Frauenhäuser gründete, den „Palais de la femme“.
Marianne Bockisch stellt vor:
Trevor Noah: Farbenblind
Verlag Karl Blessing / ISBN 978-3-89667-590-3
Meine erste Begegnung mit dem Autor fand im Internet statt, wo der farbige Comedian mit Kompetenz und Witz z.B. Präsident Trump persifliert.
1984 wurde Trevor Noah in Südafrika zu Zeiten der Apartheid geboren. Als Sohn eines Schweizers und einer südafrikanischen Xhosa war er ein Kind, das es eigentlich nicht geben durfte, denn eine solche Beziehung war unter schwere Strafe gestellt.
So wurde Trevor in den ersten Lebensjahren von seiner Xhosa-Großmutter aufgezogen, während sein Vater in die Schweiz zurück ging und seine Mutter jahrelang inhaftiert war.
2017, als er schon lange in Amerika Karriere gemacht hatte, schrieb Trevor Noah das Buch „Born a Crime“, der deutsche Titel „Farbenblind“, in dem er 18 Episoden aus seiner Kindheit und Jugend erzählt.
Den einzelnen Episoden wird jeweils ein Text mit sachlichen Informationen zum Alltag und zu den Gesetzen der Apartheid vorangestellt. Unter diesen Aspekten kann man Noahs Biographie besser verstehen und einschätzen.
Geschildert wird eine Kindheit in absoluter Armut, mit Gewalt und Brutalität und der ständigen Bedrohung, als Mischling aus der Familie entfernt zu werden. Die Mutter spielt nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis eine außerordentlich große Rolle in seinem Leben, sie vermittelt ihm menschliche und religiöse Werte. Und doch kann man ihr Verhalten oft nicht nachvollziehen. So prügelt und beschimpft sie ihn z. B. mit der Begründung: „Ich muss Dir das antun, bevor es die Polizei tut.“ Es ist bemerkenswert, wie unter diesen Umständen ein fröhliches Kind heranwächst, das viel Unsinn macht, scharfsinnig, klug und äußerst wissbegierig ist.
Noah beschreibt brenzlige Situationen aus seiner Jugend, die er manchmal mit Witz aber auch mit Charme meistert. Aus der Entfernung gesehen bringt den Leser manche Geschichte zum Lachen, aber dieses Lachen kann einem auch im Hals stecken bleiben.
Das Buch weckt in mir großen Respekt vor einem Menschen, der trotz Angst, Entbehrung und Demütigungen in der Lage ist, anscheinend ohne Verbitterung humorvoll eloquent über das Erlebte zu schreiben.
Walter Jahnke stellt vor:
Robert Löhr: Das Erlkönig-Manöver
Piper Verlag / ISBN 978-3-492-95069-5
Auf den ersten Seiten geraten Goethe und Schiller im Weimar des Jahres 1805 in eine fulminante Wirtshausschlägerei, aus der beide ziemlich blessiert entkommen können. Die deutschen Ikonen der Weltliteratur werden abrupt von ihrem Sockel geholt und als normale Menschen aus Fleisch und Blut dargestellt. So beginnt eine unglaubliche Geschichte, die von Robert Löhr mit viel Humor erzählt wird.
Am nächsten Morgen wird Goethe – reichlich lädiert – geweckt und zu Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eise- nach gerufen. Dieser hat für ihn einen ganz besonderen Auftrag: Er soll den eigentlichen, den wahren König von Frankreich aus einem Mainzer Gefängnis befreien – Ludwig XVII. Wenig später befindet er sich in Begleitung seines Freundes Friedrich Schiller und des reiseerfahrenen Alexander von Humboldt auf dem Weg ins französisch besetzte Mainz. Dazu kommen noch Achim von Arnim und Bettine Brentano und gemeinsam hecken sie einen Plan aus, um den vornehmlichen Thronprätendenten aus seiner Haft zu befreien. Unterwegs schließt sich ihnen noch der junge Heinrich von Kleist an und so begibt sich die gesammelte deutschsprachige Dichterelite ins linksrheinische Frankreich, um ihren Auftrag zu erledigen. Dabei verstellen ihnen Bonapartisten, Royalisten und Romantiker den Weg, eine tödliche Jagd quer durch Deutschland beginnt bis in die Tiefe des geschichtsträchtigsten deutschen Berges, den Kyffhäuser.
Neben der köstlichen Idee, die deutschen Klassiker in einem fiktionalen Geschichtsroman zu vereinen, ist die Sprache die Stärke des Romans. Zitate aus den bekannten Werken der Dichter werden mit hohem Wiedererkennungswert breit in die Dialoge der Protagonisten eingestreut, was die Lektüre außerordentlich amüsant macht. Gerade das hat mir – neben der Spannung besonders im ersten Teil – das Buch so lesenswert gemacht.